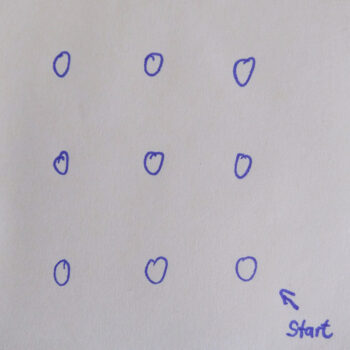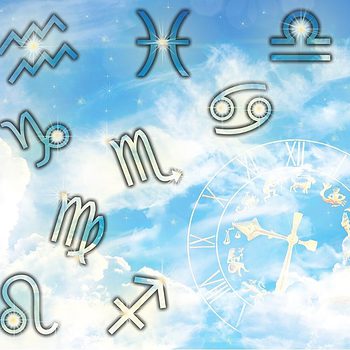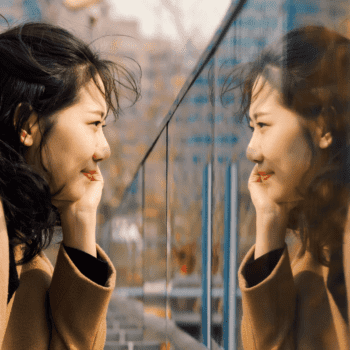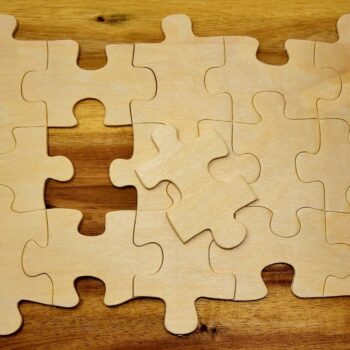Teamwork ist Mist. Finde ich jedenfalls. Nicht weil ich etwa Aversionen gegen Kolleg*innen oder Menschen im Allgemeinen hätte. Solange niemand meine Bürotasse benutzt, mag ich Menschen. Ich bin auch nicht gegen das Zusammenarbeiten. Ganz im Gegenteil, es gibt für mich nichts Erfüllenderes. Es ist nur dieses Schlagwort „Teamwork“, das mich stört.
Was genau tut man denn beim Teamwork? Zuweilen wird ja schon das zufällige „Zusammen in einer Firma arbeiten“ als Teamwork bezeichnet. Teamwork beschreibt oft nur die Verteilung von Aufgaben, die am Ende in Summe ein Ergebnis darstellen. Im schlimmsten Fall werden die Einzelwerke am Ende von den jeweils anderen „Teammitgliedern“ auch noch zerrissen.
Gute Zusammenarbeit sollte in meinen Augen anders sein. Eine Alternative wäre „Collaboration“. Mit diesem Begriff verbinde ich, dass Arbeit nicht nur in Einzelaufgaben zerlegt wird, sondern Ziele, Ressourcen, Räume, Kreativität, Erfolge und ja, auch Misserfolge geteilt werden. “Collaboration” ist, wenn nicht jede*r seinen oder ihren Teil für sich erarbeitet, sondern wenn alle etwas gemeinsam entwerfen, abstimmen und anpassen. Wenn nicht nur zusammengesetzt, sondern aufgebaut wird. Dann ist es wirklich ein gemeinsames Ergebnis.
Schon die Apostel und ersten christlichen Gemeinden hatten begriffen, dass Teilen wenig mit Aufteilen zu tun hat. In der Apostelgeschichte heißt es: „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam.“ (Apostelgeschichte 4,32)
Diese Sichtweise passt gut in unsere digitale Arbeitswelt. Wir nutzen heute Tools zur gemeinsamen, synchronen Textbearbeitung, Ticketsysteme für Aufgabenplanung, Shared Space und agiles Projektmanagement. Jeder Arbeitsschritt kann gemeinsam ausgeführt, betrachtet und entwickelt werden. Vielleicht hilft uns der Blick auf die Urgemeinden zu erkennen, dass es sich bei solchen Tools nicht nur um modische Erscheinungen oder gar Instrumente zur Arbeitsüberwachung handelt, sondern dass darin auch ein zutiefst soziales Bedürfnis nach gemeinsamen Wirken und Leben zum Ausdruck kommt. Handelt man aus dieser Haltung heraus, lassen sich mögliche negative Aspekte der “Collaboration” – etwa gläserne Mitarbeitende, Gruppendruck oder Besprechungsmarathons – vermeiden.
Anscheinend kannten die Apostel Collaboration also schon. Bloß Bürotassen kannten sie sicher noch nicht. Bei aller Liebe zur Zusammenarbeit: Finger weg von meiner Bürotasse!
Martin Deinzer, kda Nürnberg
(Titelbild: martaraptisphoto/ canva.com)